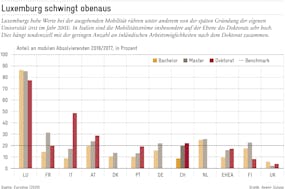Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat das Bundesamt für Statistik vor ein paar Monaten aktualisierte Zahlen zur Verteilung der verfügbaren Einkommen in der Schweiz publiziert. Sie hätten das Potenzial gehabt, die teilweise aufgebauschte Verteilungsdebatte in eine andere, gehaltvollere Richtung zu lenken als die üblichen Polemiken. Nicht, weil sie besonders spektakulär gewesen wären – ganz im Gegenteil: Sie sind so langweilig, dass sie sich kaum attraktiv darstellen lassen und sich auch nicht allzu viel dazu sagen lässt. Aber, gerade weil das so ist, müssen sie gezeigt werden.
Lassen Sie sich langweilen
Die untenstehende Abbildung basiert auf Zahlen der Haushaltsbudgeterhebung des Bundes. Gezeigt wird das verfügbare Einkommen der Erwerbsbevölkerung. Gemeint ist damit das Einkommen, das nach staatlichen Transfers und obligatorischen Abgaben tatsächlich übrigbleibt. Die Grafik zeigt die Einkommensverteilung gemessen als Gini-Index (ein übliches Mass für Ungleichheit: je höher, desto ungleicher). Zwischen 1998 und 2015 hat sich die Verteilung der verfügbaren Einkommen kaum verändert. Die Schwankungen gehen nicht über statistische Unschärfe hinaus. Das heisst nichts weniger, als, dass gemäss den offiziellen Statistiken die Verteilung in der Schweiz seit fast zwei Jahrzehnten stabil ist.
Die hier verwendeten Zahlen eignen sich allerdings in erster Linie, ein Gesamtbild zur Schweiz zu zeichnen, und weniger dazu, die Entwicklung am obersten Ende der Verteilung abzubilden. Zahlen, basierend auf Steuerstatistiken (sie zeigen die Situation vor Umverteilung), belegen, dass die obersten Einkommen in den letzten Jahren zugelegt haben. Ihr Anteil am gesamten Einkommen liegt nun wieder auf dem Stand von 1970 (das wurde zum Beispiel hier beschrieben und in einen internationalen Kontext gesetzt). Wir tun also gut daran, für verschiedene Aspekte der Verteilung verschiedene Variablen und Datensätze zu berücksichtigen.
Unterschiede zulassen
Daneben aber zeigt sich, dass sich die Verteilungsdebatte in eine quere Richtung entwickelt hat: Ungleichheit ist zu etwas geworden, das durchs Band negativ betrachtet wird. Weniger Ungleichheit, so wird postuliert, würde unsere Schweiz besser und gerechter machen. Nur, warum sollte das so sein? Ist es nicht Kern einer freiheitlichen Ordnung, dass wir Unterschiede zulassen und uns darauf konzentrieren, jenen zu helfen, die sich «aus eigener Kraft nicht mehr selbst helfen können?». Besonders für reiche und relativ gleiche Länder wie die Schweiz wäre es an der Zeit, wieder etwas entspannter auf Ungleichheit zu blicken. Wenn Ungleichheit bedeutet, dass die meisten viel und ein paar Glückliche noch mehr haben, braucht es keine Revolution einer funktionierenden Ordnung, sondern gezielte Hilfe für die objektiv Benachteiligten.